Kuratorischer Text
Hervé Guibert
This and More
10. Juni – 20. August 23
Kurator: Anthony Huberman
Assistenzkuratorin: Sofie Krogh Christensen
KW Studio über Hervé Guibert mit Anthony Huberman. Produktion: LOCOLOR, Realisation & Producer: Vincent Schaack, Kamera: Vincent Schaack, Adrian Nehm, Alejandro Mancera, Editing & Color Grading: Lia Valero
Über Hervé Guibert
Anthony Huberman
Hervé Guibert – This and More im KW Institute for Contemporary Art ist eine Fotoausstellung, und zugleich eine Ausstellung über das, was sich dem Zugriff der Fotografie entzieht.
Die Fotos stammen von dem französischen Schriftsteller, Künstler und Aktivisten Hervé Guibert (1955–1991). Vor allem als Autor bekannt, schrieb er von 1977 bis 1985 Kritiken für die Tageszeitung Le Monde und verfasste Dutzende belletristische Werke und Bücher über Fotografie. In der Vergangenheit von ihm präsentierte Fotos zeigten in der Regel Menschen.
In den Fotografien dieser Ausstellung sind hingegen Interieurs, Objekte und leere Räume zu sehen. Und obwohl auf keinem von ihnen ein Gesicht zu entdecken ist, handelt es sich doch um Porträts – es sind keine Bilder von Menschen, sondern Bilder von Beziehungen zu Menschen. Vielleicht geht es in dieser Ausstellung um den Unterschied zwischen beidem.
Montag, 9 Uhr morgens. Es nieselt.
Ich nehme mein Exemplar von Hervé Guiberts Essay-Band Phantom-Bild (1981) zur Hand. Er liegt seit Beginn der Pandemie auf meinem Nachttisch. Die 63 kurzen Texte, jeder von ihnen eine zutiefst persönliche Meditation über Fotografie, wurden als Antwort auf Roland Barthesʼ ein Jahr zuvor erschienenes Buch Die helle Kammer geschrieben, ebenfalls eine Reihe kleiner, persönlicher Reflexionen über Fotografie. In beiden Büchern geht es um den Tod, wobei sie sich nicht nur mit dem tatsächlichen Tod eines geliebten Menschen beschäftigen, sondern die Fotografie als Vermittlerin des Todes definieren.
Fotografiere nur die Leute, die dir am nächsten stehen, deine Eltern, deine Geschwister, deine geliebte Freundin, denn die alten Gefühle bestimmen das Foto …
Das ist für mich ein besonders trauriger und melancholischer, zugleich aber auch schöner Gedanke. Fotografien sind diesem Verständnis nach fragile Gebilde, die sich nicht für alles und jeden eignen. Eine Fotografie braucht demnach eine Zutat, die nicht im Bild selbst enthalten ist – eine emotionale Vorgeschichte. Etwas, das dem Bild vorausgeht und es von außerhalb belebt. Ohne das es droht, im flachen Bildraum zu stranden wie ein auf dem Meer treibender Schiffbrüchiger.
Das erinnert mich an das Bild, das ich seit zehn Jahren, oder wahrscheinlich sogar noch länger, als Hintergrundbild auf meinem Handy verwende. Eine Aufnahme von einem leeren Feld mit einer kurzen Steinmauer in der linken unteren Ecke. Die Tatsache, dass ich als Bild, das ich bei jedem Blick auf mein Handy sehe, gerade dieses ausgesucht habe, weist jedoch darauf hin, dass es für mich mehr bedeutet als die bloße Abbildung eines Feldes und einer Mauer, oder? Ich frage mich, was andere spüren, wenn sie es sehen. Nur meine Brüder und meine Mutter würden hier die Mauer um den kleinen Friedhof in Laconnex erkennen, auf dem mein Vater begraben ist.
Na gut, ab zur Arbeit.
Dienstag, 20 Uhr. Ende eines langen Tages. Ein kaltes Bier.
Wie soll man von der Fotografie sprechen, ohne von der Lust zu sprechen?
Gute Frage.
Das Bild ist das Wesen der Lust, und das Bild zu entsexualisieren hieße, es auf die Theorie zu reduzieren …
Ha, das ist witzig, weil Guibert es genau zu jener Zeit schrieb, als die Fotografie zu dem theoretischen Gegenstand par excellence wurde – eine Entwicklung, an der keine Geringeren als seine engen Freunde und Mentoren Roland Barthes und Michel Foucault maßgeblich beteiligt waren. Von Guiberts Büchern hat eines am meisten Aufsehen erregt, und zwar sein Roman Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat (1990). Darin schreibt er über sein eigenes Leben mit AIDS, und über einen engen Freund, den er im Buch „Muzil“ nannte, bei dem die Krankheit bereits weiter fortgeschritten war und der nur noch wenige Monate zu leben hatte. Dahinter verbarg sich offensichtlich Foucault – der berühmte Philosoph hatte seine Krankheit nicht öffentlich gemacht und war „offiziell“ an Krebs gestorben. Guiberts Buch trug entscheidend dazu bei, die Einstellung der französischen Öffentlichkeit gegenüber AIDS zu verändern.
Das Fotografieren ist auch eine sehr verliebte Beschäftigung. Sex und Tod. Peter Hujar, Paul Thek, David Wojnarowicz. „Sex and Death“ nannte Dodie Bellamy auch ihr Graduierten-Seminar in bildender Kunst letztes Semester am California College of the Arts (CCA): FINAR-6020-1: THEORIE: SEX UND TOD; Mittwochs, 16–17.55 Uhr; Einheiten: 3.0. Ihr Ankündigungstext erscheint mir ziemlich bedeutungsvoll:
In diesem Kurs werden wir dem Unvermeidlichen ins Auge blicken und uns mit den unterschiedlichsten Reaktionen auf den Tod wie Erinnerung, Sublimierung, Ablehnung, Schrecken und Trauer beschäftigen – vor allem dort, wo sich diese Mechanismen mit dem Eros überschneiden. Was schulden wir den Toten? Wie erweisen wir ihnen die Ehre? Wir werden uns zahlreiche kulturelle Zeugnisse ansehen, darunter Nachrufe, Fotos, Filme, Webcasts, Gedichte, Memoiren, Tagebücher, Performances, Skulpturen und Grabmale. Wir werden uns eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, Schriftstellerinnen und Schriftstellern anschauen, die sich in ihren Werken mit dem Tod und unheilbaren Krankheiten auseinandersetzen, und wir untersuchen, wie der Tod die Karrieren verschiedener Künstlerinnen und Künstler beeinflusst hat. Wir werden uns mit aktuellen und historischen Beispielen AIDS-inspirierter Kunst beschäftigen. Wir werden insbesondere den Einfluss der sozialen Medien auf die private und gemeinschaftliche Trauerarbeit in den Blick nehmen. Wie haben sie die Grenzen zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Personen neu definiert? Macht der Tod einen in den sozialen Medien ein bisschen berühmt? Wir werden uns mit Arbeiten befassen, die Krankheit und Tod einen gewissen Sexappeal verleihen, aber auch mit Werken, die uns schockieren und aus unserer Sentimentalität herausreißen. Wie wirkt sich die kollektive Trauer über schwindende ökologische und soziale Sicherheitsnetze auf unsere persönliche Trauer aus?
Hervé Guibert, Chambre de Mathieu, ca. 1989; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Hervé Guibert, Lecture, 1981; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Mittwoch, 6.45 Uhr. Die Katze hat mich wieder geweckt.
Ich bin auf Instagram. Wer ist das nicht? Ich weiß, das klingt ziemlich abgedroschen. Aber es ist auch egal, ob man auf Instagram ist oder nicht, es reicht zu wissen, dass es derzeit eine gängiges Mittel ist, Fotos zu verbreiten. Angeblich „teilen“ die Leute dort Bilder mit anderen, aber es geht dabei weder um Großzügigkeit noch um Selbstlosigkeit. Es geht nur um Begehren – das Begehren sich zu beweisen, Bestätigung zu bekommen, für sich einzunehmen.
Ich mache weiter und doppelklicke auf das unscharfe Bild einer glücklichen Familie, die vor irgendetwas steht, das wie ein Zirkuszelt aussieht, genau kann ich es nicht erkennen.
Social-Media-Fotografie ist Fotografie in ihrer optimiertesten Form. Instagram ist wie ein Tropf, der die Bilder direkt in den Blutkreislauf leitet und die Zeit überspringt, die der Körper normalerweise braucht, um Nahrung in Energie umzuwandeln. Aber diese Effizienz ist brutal, fast schon gewalttätig, und auf Dauer erschöpft und langweilt sie mich. Es ist noch nicht einmal halb neun, und ich möchte nur noch ins Bett.
Mittwoch, 8.30 Uhr. Papaya zum Frühstück.
Aber geht es bei Sex und Begehren nicht auch um das, was einem verwehrt wird, und nicht nur um das, was mühelos verfügbar ist? Mir scheint Fotografie zu leicht verfügbar zu sein. Könnte sich nicht wieder eine gewisse Distanz einstellen? Könnten sich die Bilder nicht wieder etwas von der Sichtbarkeit entfernen?
Hervé Guibert, Les Billes, 1983; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Hervé Guibert, Vertiges, o. J.; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Donnerstag, 8 Uhr morgens. Ich habe mir heute Zeit genommen, mein Hemd zu bügeln.
Wenn ich es sofort fotografiert hätte, und wenn sich das Foto als „gelungen“ (d. h. als der gefühlsmäßigen Erinnerung einigermaßen entsprechend) herausgestellt hätte, würde es mir gehören …
Der gefühlsmäßigen Erinnerung einigermaßen entsprechend – was für eine schöne Definition für ein gutes Foto. Denn die Erinnerung an ein Gefühl ist dort nicht sichtbar. Sie liegt jenseits der Reichweite von Fotografie. Sie schwirrt stattdessen um ein Foto oder in ihm herum, spukt darin, schmeichelt ihm oder reizt es vielleicht sogar wie eine Karotte vor der Nase. Es geht nicht darum, etwas einzufangen oder zu dokumentieren, sondern ein Bild in ein Phantom zu verwandeln.
In dem Foto mit den Murmeln auf dem Bett zum Beispiel ist die Hauptperson nicht zu sehen. Es wirkt wie das Phantom-Bild einer Beziehung. Die betreffende Person befindet sich vielleicht noch in der Wohnung und schneidet gerade in der Küche Gemüse, oder sie ist womöglich schon vor Monaten gestorben, nachdem ihr Körper den Dienst versagt und nur die Murmeln hinterlassen hat. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie nie zuvor auf diesem Bett gelegen haben und Guibert das Ganze nur inszeniert hat. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle, denn das Motiv des Bildes sind nicht das Bett oder die Murmeln oder die Schatten auf dem Bettlaken und auch nicht die Person, die vielleicht in der Küche ist oder die womöglich verstorbene Person. Um Guiberts eigene Formulierung aufzugreifen: Das Bild verweist auf die Erinnerung an ein Gefühl – und diese visuellen Elemente sind prägnante und aussagekräftige Vehikel für emotionale Dynamiken, die so chaotisch und dynamisch sind, dass sie auf einer Filmrolle unmöglich festgehalten werden können.
Das Foto der Murmeln auf dem Bett ist weniger ein Bild von Murmeln auf einem Bett als vielmehr Guiberts Versuch, „eine Form zu finden, die das Chaos beherbergt“, um den zeitlosen Samuel Beckett zu zitieren.
So meine Meinung dazu.
Donnerstag, 8.20 Uhr. Kaffee über die ganze Küchenanrichte verschüttet.
Also … ich möchte damit sagen, dass diese Fotos keine Objektivität oder „Wahrheit“ vermitteln wie ein Bildreporter, der eine Szene dokumentiert, sondern sie kommen genau an das heran, was die Fotografie nicht vermitteln kann. Sie kann keine Erinnerungen, keine Anekdoten, keine Fehlstellen, keine Subjektivität darstellen und auch nicht die Wärme eines Körpers, der gerade den Raum verlassen hat, oder die schmerzliche Trauer, die sich bei der Erinnerung an eine verlorene Liebe einstellt. Wenn diese Fotos nur einen Tisch, eine Puppe oder eine Fensterbank zeigen und keine Menschen, dann ist ihr eigentlicher Zweck, Platz für all jenes zu schaffen, das in einem Bild schlummert, das für das Auge unsichtbar, aber für das Bild von zentraler Bedeutung ist. Guiberts Fotos sind Bilder dessen, was in Bildern nicht vorkommt. Sie thematisieren die Grenzen der Fotografie und verwandeln ihre Schwäche in eine Stärke. Wenn es bei einer Fotografie immer um etwas „Gewesenes“ geht, wie Barthes behauptete, dann nutzt Guibert sie nicht, um etwas zu dokumentieren oder festzuhalten, sondern um eine phantomhafte Distanz zwischen einer Erfahrung und ihrem Nachbild zu schaffen.
Donnerstag, 15.30 Uhr. Zwischen Zoom-Meetings.
Ich frage mich, ob Juana die neuen Blumen aufgefallen sind, die ich ins Esszimmer gestellt habe.
Hervé Guibert, La bibliothèque, 1986; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Hervé Guibert, Message incompréhensible, 1990; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Donnerstag, 22 Uhr. Der Vorhang im Schlafzimmer hat eine Lücke.
Ich habe gelesen, dass Guibert von allem besessen war, was weggeht oder verschwindet, was absolut nachvollziehbar erscheint.
Viele nutzen Fotos, um solche Verluste zu vermeiden, als könnte das Bild eines Augenblicks oder einer Person, die es einmal gab, deren Anwesenheit konservieren. Nicht so Guibert: Ich habe keine Lust, mich an diese trivialen Momente zu erinnern, wenn wir uns für ein Foto aufstellten: die dabei entstandenen Bilder sind nichtssagend und weit weniger intensiv als die Erinnerung. Seine Fotos lassen es hingegen geschehen, dass Menschen und Dinge verschwinden.
Zwar nahm Guibert häufig Fotos von Menschen auf, aber er war sich auch des Paradoxons bewusst, dass es Bilder waren, die sich darauf beschränkten, auf plumpe Art ein Gesicht, eine Physiognomie wiederzugeben. Ein Bild des Gesichts seiner Mutter sagte nichts über unsere mögliche Beziehung, über die Zuneigung, die ich ihr entgegenbringen konnte, aus. Vielleicht ist es sogar gerade das Gesicht, das im Weg steht – seine zu deutliche Abbildung führt dazu, dass die Sicht auf die abstrakteren hier wirksamen Kräfte verdeckt wird. Was greifbar ist, ist das Gesicht, aber was zählt, ist die Beziehung.
Ich weiß genau, daß dieses Gesicht, das echte, vollkommen aus meiner Erinnerung verschwinden wird, fortgejagt vom fühlbaren Beweis des Bildes. Der beste Weg, um sich dieses Gesicht zu merken, ist es also, ein Foto mit Murmeln auf einem Bett zu machen.
Freitag, Mittag. Dieser Radiosender gefällt mir wirklich gut.
Der erste Essay in Phantom-Bild ist großartig. Guibert erzählt die Geschichte, wie er seine Mutter nach langem Zureden endlich davon überzeugen konnte, sich porträtieren zu lassen. Sein Vater war dagegen, also musste es hinter seinem Rücken geschehen, wenn er nicht zu Hause war. Als Guibert mit dem Fotografieren begann, erlaubte sich seine Mutter, eine Person zu sein, die sie normalerweise nicht sein durfte, und sie erschien ihm im Sucher um Jahre jünger als sie tatsächlich war, mit einem so glatten und entspannten Gesicht, dass er sie kaum wiedererkannte. Aber der Film war nicht richtig in die Kamera eingelegt, und so wurde das Foto nichts. Indem Guibert eine Geschichte darüber schreibt, gibt er dem Bild eine andere Form – die außerhalb des Bereichs des Sichtbaren liegt. Eines von vielen Phantom-Bildern, versteckten, derart intimen Bildern, daß sie nicht sichtbar sind. Das Gegenteil von Instagram.
Diese Fotos sagen nichts darüber aus, was geschehen ist, sondern widmen sich dem, was innerhalb des Geschehenen ist. Sie weben Geschichten, indem sie Fakten und Fiktion vermischen, wie es jeder gute Geschichtenerzähler tut.
Freitag, 23 Uhr. Fertig gepackt.
Habe gerade daran gedacht, ein Taxi für morgen früh zu buchen. Muss am Flughafen eine neue Zahnbürste kaufen.
Hervé Guibert, Le rêve de cinéma, 1982; © Christine Guibert/Mit freundlicher Genehmigung von Les Douches la Galerie, Paris.
Künstlerbiografie
Hervé Guibert (1955–1991, Paris, Frankreich) war ein Romanautor, Fotograf und Fotokritiker. Sein erstes Buch, Propaganda Death, veröffentlichte er 1977 im Alter von 22 Jahren. Im selben Jahr begann er, eine Kolumne über Fotografie für Le Monde zu schreiben, und arbeitete bis 1985 als Chef-Fotokritiker der Zeitung. Er schrieb über Künstler, Schriftsteller und Philosophen wie Patrice Chéreau, Roland Barthes, Isabelle Adjani, Michel Foucault, Miquel Barceló und Sophie Calle. Zwischen 1977 und seinem frühen Tod 1991 schrieb er mehr als fünfundzwanzig Romane und Kurzgeschichten, immer in der ersten Person, darunter Suzanne und Louise (1980), Ghost Image (1982), Blindsight (1985), Crazy for Vincent (1989), von denen mehrere kürzlich ins Englische übersetzt und von Semiotext(e) veröffentlicht wurden. Sein 1990 erschienener Roman An den Freund, der mir nicht das Leben rettete verschaffte ihm mediale Aufmerksamkeit und öffentliche Bekanntheit, da es sich dabei um ein kaum verhülltes Porträt seines Freundes Michel Foucault handelte und eine wichtige Rolle bei der Veränderung der öffentlichen Haltung gegenüber AIDS in Frankreich spielte. 1992 strahlte das französische Fernsehen posthum La Pudeur ou l’impudeur aus, einen Film, den Guibert von sich selbst drehte, als er seinen Kampf gegen AIDS verlor.
Guiberts Fotografien waren Gegenstand einer Retrospektive im Maison Européenne de la Photographie in Paris im Jahr 2011 und in der Loewe Foundation in Madrid im Jahr 2019. Weitere aktuelle Einzelausstellungen wurden bei Callicoon Fine Arts in New York (2014 und 2019), in der Galerie Les Douches in Paris (2018, 2020, 2021), in der Kristina Kite Gallery in Los Angeles (2018) und in der Galerie Felix Gaudlitz in Wien (2020) gezeigt.
Impressum
Kurator: Anthony Huberman
Assistenzkuratorin: Sofie Krogh Christensen
Produktionsleitung: Mathias Wölfing, Claire Spilker (in Elternzeit)
Technische Leitung: Wilken Schade
Leitung Aufbauteam, Medientechnik: Markus Krieger
Aufbau: KW Aufbauteam
Registrarin: Monika Grzymislawska
Assistenzregistrarin: Carlotta Gonindard Liebe
Leitung Bildung und Vermittlung: Laura Hummernbrum, Alexia Manzano (in Elternzeit)
Programmkoordinator und Outreach: Nikolas Brummer
Presse und Kommunikation: Anna Falck-Ytter, Marie Kube
Assistenz Presse und Kommunikation: Luisa Schmoock
Text und Redaktion: Anthony Huberman
Übersetzung und Lektorat: Dr. Sylvia Zirden, Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen
Wissenschaftliches Volontariat: Lara Scherrieble
Praktikantinnen: Isabella de Arruda Ilg, Pia Gottschalk, Marie Hütter, Teresa Millich
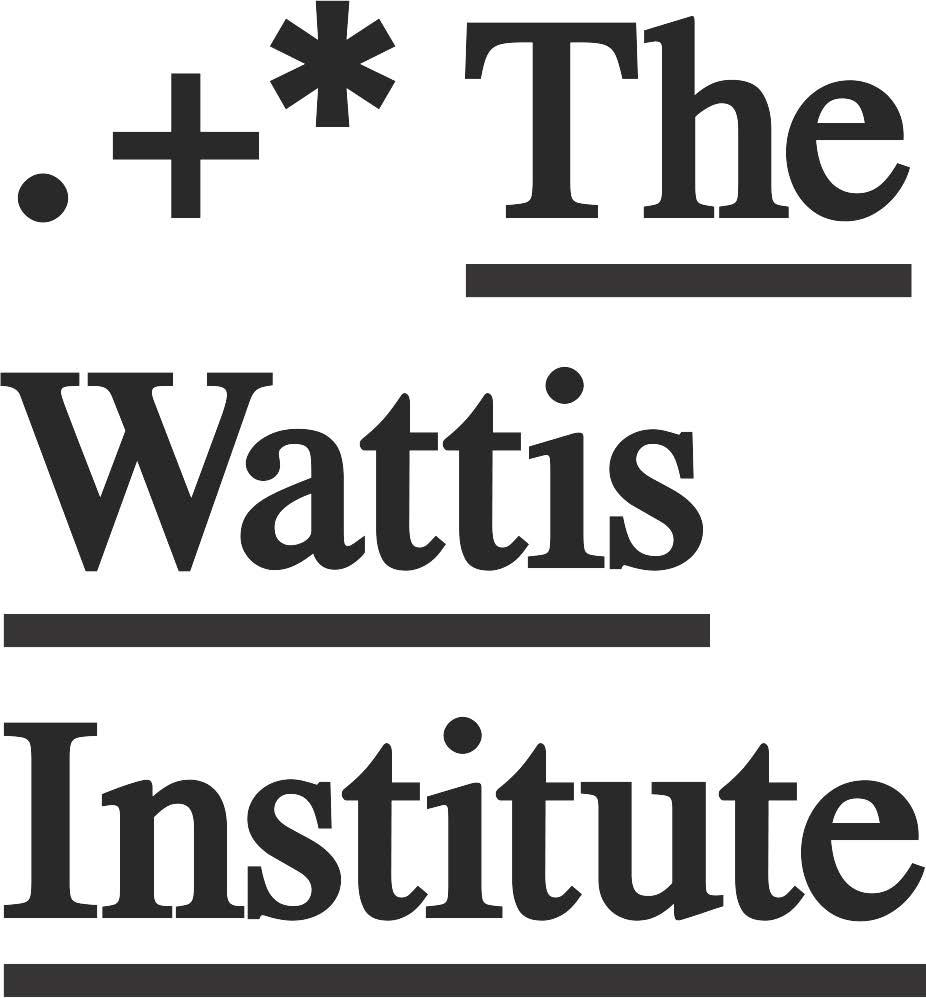
Die Ausstellung Hervé Guibert – This and More wird vom CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco organisiert. Besonderer Dank gilt Christine Guibert und Françoise Morin von der Galerie Les Douches sowie Photi Giovanis von Callicoon Fine Arts. Die Ausstellung wurde zuerst im CCA Wattis Institute for Contemporary Arts gezeigt (Juni–Juli 2022) und ist im MACRO – Museum of Contemporary Art of Rome zu sehen (März–Mai 2023), bevor sie in den KW Institute for Contemporary Art präsentiert wird.

Medienpartner: arte








